20. November 2023
SPD/Zukunftsgespräche
Nicht die KI entscheidet, ob Olaf Scholz ein guter Kanzler ist – Enrico Kreft über talentfreie Redenschreiber:innen und Macken künstlicher Intelligenz in der Politik

- Enrico Kreft
Künstliche Intelligenz übernimmt unsere Jobs, ChatGPT schreibt Reden und beantwortet Bürger:innenanfragen, und die Politik kommt schon beim Thema Digitalisierung nicht hinterher? Wenn die Welt um eine:n herum durchzudrehen scheint, braucht man einen klaren Kopf und gutes Technologieverständnis, um sich nicht von jedem Trend mitreißen zu lassen und sich mit progressiven Ideen für Technologie einzusetzten, die den Menschen dient. Enrico Kreft – geboren in Mecklenburg, wohnhaft in Lübeck, Mitglied des Landesvorstands SPD Schleswig-Holstein und seit 2017 Sprecher des Arbeitskreises Digitale Gesellschaft – kommentiert und ergänzt einige der aktuellen Ideen und Aktivitäten, die die künstliche Intelligenz und Cybersicherheit betreffen.
„[…] In der Partei muss über mehr diskutiert werden als das jeweils gerade zu verabschiedende Gesetz.“[1]
(Wolfgang Thierse zum 80. Geburtstag von Thomas Meyer und Wolfgang Thierse in „Soziale Demokratie als Überlebenspolitik. Wolfgang Thierse und Thomas Meyer im Gespräch über die politischen Zeitläufe“, erschienen im Schüren Verlag, 2023)
Eine der deutschen Regierungsparteien, FDP, hat kürzlich angekündigt, künstliche Intelligenz (KI) in der politischen Arbeit zu nutzen. Tools, wie ChatGPT, sollen zum „Reden schreiben oder Bürgerbriefe beantworten“ eingesetzt werden. Selbstverpflichtungen sollen den Abgeordneten als Wegweiser für den ethischen und datenschutzgerechten Einsatz der KI bei den politischen Entscheidungen oder beim Redenschreiben dienen. Der forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU, Thomas Jarzombek, kommentierte den Beschluss der FDP-Fraktion dem Handelsblatt gegenüber und sah aktuell wenig Bedarf für Selbstverpflichtungen – wie auch für von Sprachmodellen wie ChatGPT geschriebene Bundestagsreden. Parsa Marvi von der SPD-Bundestagsfraktion sprach sich laut Handelsblatt für Selbstverpflichtungen aus.
Für einige Bundestagsabgeordnete scheint der Einsatz von generativen KI-Modellen in ihrer Arbeit oder in ihren Reden ein Signal der Modernität, der Progression, ja der Zeitenwende zu sein. Sie kokettieren mit den „Schlüsseltechnologien“ ihre politischen Gegner, insinuieren, damit schneller und besser zu arbeiten als ihre Kolleginnen und Kollegen. Denn KI, so die Annahme, sollte ihre Arbeit enorm erleichtern, Komplexität reduzieren, Kommentierungen der Verbände zusammenfassen oder Argumentationshilfen für Debatten liefern. Andererseits ist mit Bemerkungen, eine Rede sei (offenbar) von ChatGPT geschrieben worden, im Bundestag als verdeckte Kritik an der Qualität oder den Inhalten derselbigen gemeint.
„Bei aller Begeisterung, die ChatGPT und ähnliche Anwendungen auch bei mir auslösen: Wir benötigen Regeln und Orientierung“, sagt Enrico Kreft. „Und möglicherweise ist das Benutzen von AI beim Beantworten von Bürger:innenbriefen nicht die schlaueste Idee. Bürger:innen reagieren schon enttäuscht, wenn sie standardisierte Antwortbriefe erhalten. Es geht nicht immer nur um Schnelligkeit, sondern um Authentizität, Anstand und Gründlichkeit im menschlichen Umgang. Ich verstehe die Überheblicheit nicht: Natürlich hat ChatGPT noch Macken, aber es gibt auch talentfreie Redenschreiber:innen und nicht nur gute Redner:innen in den Parlamenten.“
Im Papier der SPD vom Mai 2023: Sozialdemokratische Digitalpolitik: Ein Update für das Jahrzehnt der Transformation wurde zwar der Einsatz von KI in der Politik oder im Bundestag nicht explizit behandelt, doch wurden darin insgesamt Rahmen für Standardisierung, Normung sowie – sehr wichtig – Leitplanken für die Ausrichtung der KI-Entwicklung formuliert. Bei der Gestaltung des technologischen Wandels lassen sich die Autorinnen und Autoren von den sozialdemokratischen Grundwerten – Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität – leiten: „Damit der digitale Wandel in einem sozialen Fortschritt mündet, müssen wir ihn in Deutschland, Europa und international aktiv gestalten“, heißt es in dem Papier.
Enrico Kreft: „Unsere liberale Demokratie steht enorm unter Druck. Zur Legitimation unserer Demokratie rate ich zur direkten, persönlichen Kommunikation zwischen Abgeordneten und Bürger:innen. AI könnte hier noch mehr gefährliche Distanz schaffen.“
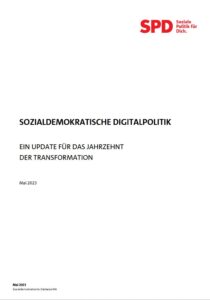 Für den Einsatz der KI (das Thema vereinnahmt immerhin fast drei Seiten des insgesamt 28-seitigen Papiers) sehen die Autorinnen und Autoren konkret: „Anwendungen der künstlichen Intelligenz können unser Leben vereinfachen und durch einen domänspezifischen Einsatz effektivere Verwaltung, bessere Medizin und gerechtere Bildung unterstützen.“ Der Einsatz der KI – das „was wir daraus machen“ – geht über das Schreiben von Reden der Abgeordneten hinaus und fokussiert sich auf bestimmte Themenbereiche, wie Medizin, Gesundheitswesen, Datennutzung sowie Verwaltung. „Eine resiliente, demokratische Gesellschaft braucht einen modernen, handlungsfähigen Staat“, betonen die Autorinnen und Autoren, „[d]azu gehört für uns im 21. Jahrhundert eine digitale Daseinsvorsorge, deren Aufgaben einen diskriminierungs- und barrierefreien Zugang zum Internet für alle Menschen umfasst sowie die Verpflichtung, die Dienstleistungen der Verwaltung durchgängig digital anzubieten.“ Wobei sich die KI als Schlüsseltechnologie aus der Digitalisierung zunehmend herausemanzipiert.
Für den Einsatz der KI (das Thema vereinnahmt immerhin fast drei Seiten des insgesamt 28-seitigen Papiers) sehen die Autorinnen und Autoren konkret: „Anwendungen der künstlichen Intelligenz können unser Leben vereinfachen und durch einen domänspezifischen Einsatz effektivere Verwaltung, bessere Medizin und gerechtere Bildung unterstützen.“ Der Einsatz der KI – das „was wir daraus machen“ – geht über das Schreiben von Reden der Abgeordneten hinaus und fokussiert sich auf bestimmte Themenbereiche, wie Medizin, Gesundheitswesen, Datennutzung sowie Verwaltung. „Eine resiliente, demokratische Gesellschaft braucht einen modernen, handlungsfähigen Staat“, betonen die Autorinnen und Autoren, „[d]azu gehört für uns im 21. Jahrhundert eine digitale Daseinsvorsorge, deren Aufgaben einen diskriminierungs- und barrierefreien Zugang zum Internet für alle Menschen umfasst sowie die Verpflichtung, die Dienstleistungen der Verwaltung durchgängig digital anzubieten.“ Wobei sich die KI als Schlüsseltechnologie aus der Digitalisierung zunehmend herausemanzipiert.
„Soll der digitale Wandel gelingen, müssen wir viel Ressourcen in die Beziehungsarbeit von Mensch zu Mensch stecken“, stellt Enrico Kreft klar, „KI-Anwendungen müssen uns als Gesellschaft nutzen. So abgedroschen es klingen mag: Der Mensch steht im Mittelpunkt. Hieran müssen sich Aufgabengebiete von künstlicher Intelligenz messen lassen.“
 Die Themen IT-Sicherheit und Resilienz, die ebenfalls in dem Papier zur Digitalpolitik behandelt wurden, verweisen zwar auf die Förderung und den Aufbau von Schlüsseltechnologien in Deutschland, doch ohne dabei explizit auf den Einsatz von KI für oder wider der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einzugehen. „[Wir] werden […] das Recht auf Verschlüsselung schaffen“, das „Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität von IT-Systemen weiter ausgestalten“ sowie die „Integrität und Sicherheit von IT-Systemen“ als staatliche Verpflichtung betrachten, „sodass dem Staat eine Gewährleistungspflicht gegenüber seinen Bürger*innen zukommt“. Im Hinblick auf die anlasslose Kontrolle digitaler Kommunikation, die anlasslose Datenspeicherung, das Aufbrechen von Verschlüsselung oder das Zurückhalten von Schwachstellen durch den Staat werden diese im Papier abgelehnt. Aber auch relativiert: „Gleichzeitig muss der Staat eine wirksame und effektive Strafverfolgung sicherstellen.“ Wie man diesen Spagat konkret in der Umsetzung schafft, gerade angesichts der Projekte des Bundesinnenministeriums bzgl. der Chatkontrolle, Vorratsdatenspeicherung oder dem Horten von IT-Schwachstellen, Hackbacks etc., bleibt offen.
Die Themen IT-Sicherheit und Resilienz, die ebenfalls in dem Papier zur Digitalpolitik behandelt wurden, verweisen zwar auf die Förderung und den Aufbau von Schlüsseltechnologien in Deutschland, doch ohne dabei explizit auf den Einsatz von KI für oder wider der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einzugehen. „[Wir] werden […] das Recht auf Verschlüsselung schaffen“, das „Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität von IT-Systemen weiter ausgestalten“ sowie die „Integrität und Sicherheit von IT-Systemen“ als staatliche Verpflichtung betrachten, „sodass dem Staat eine Gewährleistungspflicht gegenüber seinen Bürger*innen zukommt“. Im Hinblick auf die anlasslose Kontrolle digitaler Kommunikation, die anlasslose Datenspeicherung, das Aufbrechen von Verschlüsselung oder das Zurückhalten von Schwachstellen durch den Staat werden diese im Papier abgelehnt. Aber auch relativiert: „Gleichzeitig muss der Staat eine wirksame und effektive Strafverfolgung sicherstellen.“ Wie man diesen Spagat konkret in der Umsetzung schafft, gerade angesichts der Projekte des Bundesinnenministeriums bzgl. der Chatkontrolle, Vorratsdatenspeicherung oder dem Horten von IT-Schwachstellen, Hackbacks etc., bleibt offen.
Enrico Kreft: „Die Ersten drängeln schon, KI unter Inkaufnahme datenschutzrechtlicher Komplikationen einzusetzen. Ich dränge darauf von vorneweg, Datenschutz mitzudenken und so als Gestaltungsraum anzunehmen und in diesen Grenzen sensibel mit Daten der Bürger:innen und der Verwaltung umzugehen. Wir brauchen dringend das Vertrauen zwischen Bürger:innen und Staat, gerade von denen, die technisch nicht versiert sind.“
Das Papier Sozialdemokratische Digitalpolitik verweist auf zwei wesentliche Aspekte der Technologie: die Grenzsetzung i. S. v. europaweiter Regulierung und Ausrichtung an europäischen Werten und Grundrechten sowie Wesentlichkeit partizipativer Elemente bei den Entscheidungen über die Entwicklung von KI: „Wir müssen dafür sorgen, dass generative KI-Systeme allen Menschen zur Verfügung stehen und einen gesellschaftlichen Mehrwert ermöglichen. Darum setzen wir uns für einen gemeinwohlorientierten Einsatz von KI-Modellen ein, der durch die Gesellschaft demokratisch kontrolliert wird.“  An der Stelle geht das Themenpapier der Grundwertekommission Staatlichkeit in der sozialökologischen Transformation: mehr Legitimation durch Partizipation vom August 2023 noch einen Schritt weiter, indem Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei den Entscheidungen über die Nutzung der Technologien – oder eben gegen diese – gefordert wird: „[e]ine Reform der Verwaltung im sozialdemokratischen Sinne erfordert eine Strategie, die auf demokratischen Werten basiert. Dazu gehören die Wahlmöglichkeit von Technologien, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die Einbeziehung der Bürger in demokratische Entscheidungsprozesse.“ Demnach sollten Bürgerinnen und Bürger direkt in Entscheidungen über den Einsatz (oder den Nichteinsatz) von Technologien einbezogen werden, die die Verwaltung betreffen. Die Empfehlung der Grundwertekommission: „Die Sozialdemokratie muss die Förderung begründeter Zuversicht durch partizipative Erfahrungen und die daraus resultierende Beeinflussung viel stärker als bisher in den Mittelpunkt ihrer politischen und gesellschaftlichen Arbeit rücken.“
An der Stelle geht das Themenpapier der Grundwertekommission Staatlichkeit in der sozialökologischen Transformation: mehr Legitimation durch Partizipation vom August 2023 noch einen Schritt weiter, indem Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei den Entscheidungen über die Nutzung der Technologien – oder eben gegen diese – gefordert wird: „[e]ine Reform der Verwaltung im sozialdemokratischen Sinne erfordert eine Strategie, die auf demokratischen Werten basiert. Dazu gehören die Wahlmöglichkeit von Technologien, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die Einbeziehung der Bürger in demokratische Entscheidungsprozesse.“ Demnach sollten Bürgerinnen und Bürger direkt in Entscheidungen über den Einsatz (oder den Nichteinsatz) von Technologien einbezogen werden, die die Verwaltung betreffen. Die Empfehlung der Grundwertekommission: „Die Sozialdemokratie muss die Förderung begründeter Zuversicht durch partizipative Erfahrungen und die daraus resultierende Beeinflussung viel stärker als bisher in den Mittelpunkt ihrer politischen und gesellschaftlichen Arbeit rücken.“
Enrico Kreft hat Zweifel, „ob hier Beteiligung die richtige Stellschraube ist. Ich setze darauf, Entscheidungsträger:innen in Politik und Verwaltung so fit sind/gemacht werden, dass sie weiter in der Verantwortung sind, komplexe und schwierige Entscheidungen zu treffen. Ich widerspreche also dem Grundgedanken der Grundwertekommission, nicht weil ich den Gedanken zu beteiligen falsch finde, sondern aus der Praxis heraus eher zur Einschätzung komme, dass das nur wenige erreichen wird.“
In ihrem Beschluss zur KI verpflichtet sich die FDP-Fraktion u. a. dazu, „ethische Überlegungen“ in die Entscheidungen einfließen zu lassen und KI-generierte Inhalte zu kennzeichnen. Auch sollten Entscheidungen niemals ausschließlich auf der Grundlage von durch KI generierten Ergebnissen getroffen werden, sondern kritischer Prüfung bspw. im Rahmen „systematischer Faktenchecks“ unterzogen werden. Das SPD-Papier zur sozialdemokratischen Digitalpolitik ist an dieser Stelle entschieden konkreter: „Wir wollen ‚Human in Command‘ – wo es nötig ist, muss der Mensch beim Einsatz künstlicher Intelligenz das letzte Wort haben. Insbesondere dort, wo Entscheidungen getroffen werden, die die Lebenschancen und die persönliche Entwicklung eines Menschen betreffen, brauchen sie Kontrolle durch eine kompetente und souveräne menschliche Letztentscheidung.“ Dies möchte man weniger mithilfe freiwilliger Selbstverpflichtungen, wie bei der FDP-Fraktion, erreichen. Vielmehr müssten hierfür „die notwendigen rechtlichen und technischen Voraussetzungen“ geschaffen werden.
„Klare Regeln sorgen für die nötige Orientierung. Einer künstlichen Intelligenz dürfen niemals die Entscheidung übertragen werden, für uns zu entscheiden, ob Olaf Scholz ein guter Bundeskanzler ist. Das müssen wir als aktive, fühlende und denkende Menschen schon selbst machen.“ Die „Human in Command“-Verantwortung sei nicht teilbar, pointiert Enrico Kreft.
In der Ausgabe 12/2023 der Zeitschrift Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte erscheint der Beitrag „Progressives Regieren 1.6 – (noch) gänzlich ohne KI“ von Enrico Kreft und Aleksandra Sowa.
[1] Siehe auch https://vorwaerts.de/artikel/wolfgang-thierse-diese-spannung-spd-wichtig.
